«Dereinst verhindern wir den Herzinfarkt ganz»
Forschung sei immer ein unsicheres Geschäft, sagt Prof. Thomas F. Lüscher, Vorsitzender der Kommission Forschung der Schweizerischen Herzstiftung. Ohne Forschung jedoch hätte die Kardiologie nicht die enormen Fortschritte verzeichnet. In welche Entwicklungen er seine Hoffnung steckt, erklärt Lüscher im Interview.
Was beruft einen zum Kardiologen?
Prof. Thomas F. Lüscher: Das ist bei jedem verschieden. Ursprünglich wollte ich Psychiater oder Neurologe werden. Als mein Vater einen plötzlichen Herztod hatte, stellte ich mir die Frage, weshalb jemand auf einen Schlag stirbt. Herz und Kreislauf interessierten mich immer mehr. Und wie wird man tatsächlich Kardiologe? Nach dem Medizinstudium muss man zwei Jahre Innere Medizin als Assistenzarzt absolvieren. Also ein wenig alles kennenlernen. Es folgen vier Jahre Weiterbildung in der Kardiologie. So wird man zum Facharzt für Kardiologie, aber spezialisierte Eingriffe beherrscht man noch nicht. Die Kathetertechnik oder Bildgebung beispielsweise verlangen weitere Jahre Ausbildung.

Welche Eigenschaften braucht ein guter Kardiologe, eine gute Kardiologin?
Erstens sollte er oder sie ein gescheiter Kopf sein. Dann kommt es darauf an, was man genau macht. Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Wer Bildgebung betreibt und Diagnosen stellt, hat eher eine nachdenkliche, visuell geprägte Persönlichkeit. Wer hingegen den Herzkatheter bedient, muss ein wenig ein Cowboy sein, also selbstsicher und mutig. Man behandelt mitten in der Nacht einen Patienten, der einen Herzinfarkt hat und jederzeit sterben kann. Dies hält nicht jeder aus. Wir benötigen in der Kardiologie also verschiedene Fähigkeiten für verschiedene Aufgaben.
An einem Universitätsspital behandelt man nicht nur Patienten. Forschung und Lehre gehören ebenfalls zu den Aufgaben einer Professur. Was gefällt Ihnen am besten?
Mir gefällt die Kombination. Die Kardiologie ist eines der wenigen Fächer, in denen man forschen und auch behandeln kann. Ich habe viel am Herzkatheter gearbeitet und gleichzeitig Grundlagenforschung betrieben.
Dann haben Sie hautnah erlebt, welche Fortschritte die Kardiologie in den letzten Jahren gemacht hat.
Als der US-amerikanische Präsident Eisenhower am 23. September 1955 einen Herzinfarkt erlitt, konnten die Ärzte nichts ausrichten. Sogar das EKG-Gerät mussten sie aus einem entfernten Spital holen. Die Todesfallrate – für diejenigen, die es überhaupt ins Spital schafften – lag damals bei 50 Prozent. Inzwischen liegt sie bei fünf bis zehn Prozent. Jemand mit einem Infarkt fährt heute mit Blaulicht ins nächste Herzzentrum und ist sofort im Herzkatheterlabor. Wir gehen mit dem Katheter rein, öffnen das Gefäss und das Problem ist fürs Erste gelöst. Die enorme Entwicklung ist der Tatsache zuzuschreiben, dass die Kardiologie eine forschungsorientierte Disziplin war und ist. Es gibt kaum ein Gebiet, wo es so viele grosse randomisierte Studien und breite Grundlagenforschung gibt.
Trotz der grossen Erfolge zweifeln immer mehr Menschen an den Aussagen von Wissenschaftlern. Wie sehen Sie dies?
Die Suche nach der Wahrheit hat die Menschen und vor allem die Philosophen schon immer beschäftigt. Der Unterschied zwischen Religion oder Ideologie und der Wissenschaft ist, dass wir Wissenschaftler unsere Meinung immer wieder hinterfragen müssen. Wir machen Experimente und messen, ob eine Aussage stimmt oder nicht. Und wenn die Studien nicht bestätigen, was ich vorher angenommen habe, dann muss ich meine Meinung ändern, auch wenn es mir schwerfällt. Dies ist mir ein paar Mal passiert. Wissenschaft ist ein anstrengender, kühl wirkender Umgang mit Daten und Zahlen. Das sind keine grossartigen Geschichten, die man sich am Lagerfeuer erzählt.
Forschung sei ein unsicheres Geschäft, haben Sie einmal geschrieben. Was meinten Sie damit?
Erstens sind die meisten unserer Hypothesen falsch. Es braucht viel Glück, bis man als Forscher ein goldenes Ei legt, wie es der Schweizer Nobelpreisträger Rolf Zinkernagel ausgedrückt hat. Dann sind wissenschaftliche Theorien nie abgeschlossen, sie sind vorläufig und werden ständig der Wirklichkeit angepasst. Drittens sind die meisten Positionen für Forscherinnen und Forscher unsicher. Einem Forschungsprojekt kann plötzlich das Geld ausgehen.

Wie wichtig ist die Forschungsförderung von nicht-staatlicher Seite wie beispielsweise der Schweizerischen Herzstiftung?
Enorm wichtig. Die klinisch tätigen Forscher bekommen von Universitäten praktisch kein Geld, höchstens Räume. Alles andere müssen wir durch Drittmittel finanzieren. Das ist der Nationalfonds und – in der Herzforschung ganz zentral – die Schweizerische Herzstiftung. Doch die jetzigen Mittel reichen kaum, um im weltweiten Wettbewerb mithalten zu können. Wir brauchen mehr Menschen, die unsere Forschung grosszügig unterstützen.
Welche Herausforderungen hat die Herzmedizin in der nächsten Zukunft angesichts einer alternden Bevölkerung?
Die meisten Herzerkrankungen sind Alterserkrankungen. Wir bekommen sie, weil in der Evolution nicht vorgesehen ist, dass wir so alt werden. Ein Beispiel ist das Cholesterin: Tiere bekommen keinen Herzinfarkt. Wir Menschen jedoch haben nicht zuletzt aufgrund unseres Lebensstils Cholesterinwerte, die um ein X-Faches höher sind als bei anderen Säugetieren. Das wirkt sich im ersten Lebensabschnitt selten aus. Mit zunehmendem Alter aber verursacht dies einen Herzinfarkt.
Was bedeutet dies für die Medizin?
Die Alterungs- und Krankheitsprozesse sind genetisch gesteuert. Nicht jeder mit einem hohen Cholesterinspiegel bekommt einen Herzinfarkt. Die Gene, die das Altern steuern, bestimmen auch, ob wir eine altersbedingte Krankheit bekommen oder nicht. Indem man nun diese Gene verändert, könnte man dafür sorgen, dass wir bestimmte Krankheiten nicht erleiden, also gegen hohen Cholesterinspiegel oder Diabetes resistent sind. Im Labor haben wir dies schon nachweisen können, die klinische Anwendung braucht aber noch weitere Forschung.
Ist das ein möglicher Weg für neue Behandlungsmethoden?
Der nächste grosse Entwicklungsschritt wird in der Genetik stattfinden. Das braucht zwar noch viele Jahre. Gute Fortschritte haben wir aber schon bei den genetischen Erkrankungen erzielt. Nehmen Sie die angeborenen Herzmuskelerkrankungen. Ein vermeintlich gesunder Patient stirbt mit 30 Jahren beim Fussballspiel an einem plötzlichen Herztod. Wir kennen heute die Gene, die diese Krankheit verursachen und können mit Defibrillatoren das Schlimmste vermeiden. Aber heilen können wir diese Patienten nicht. Eine Genschere, das sogenannte CRISPR/Cas9, kann nun diese Gene herausschneiden und durch andere ersetzen. Es ist eine Frage der Zeit, bis wir solche monogenetischen Krankheiten zumindest im frühen Alter auch bei Patienten heilen können.
Und auf dem Weg dorthin, welche Alternativen gibt es?
Unser grosses Problem ist, dass wir Herzkrankheiten zwar behandeln können, aber nicht heilen. Für Patienten bedeutet dies, dass sie ein Leben lang Medikamente schlucken müssen. Das ist mühsam und die Wirkung ist nicht optimal. Um beim Cholesterin zu bleiben: Wir suchen nun einen Wirkstoff, der in den Leberzellen gezielt das Gen für ein Eiweiss abstellt, das die LDL-Rezeptoren reguliert. Dadurch sinkt das LDL-Cholesterin für sechs Monate stark. Irgendwann wird es uns gelingen, das Gen über Jahre oder ganz abzustellen. Dann gibt es auch keine Herzinfarkte mehr. Wir kommen von den Kräutern über die Medikamente, die an der Zelloberfläche wirken, zu den Wirkstoffen, die in die Maschinerie der Zelle eingreifen. Dies ist eine völlig neue Welt.
Spielt unser ungesunder Lebensstil irgendwann keine Rolle mehr?
Nein, unser Lebensstil bleibt ein grosses Problem. Wir bewegen uns immer weniger, der Kalorienverbrauch nimmt ab. In der Migros können wir uns so viel Lebensmittel kaufen, wie wir wollen. Damit nimmt unser Gewicht vor allem im Alter zu. Wir sprechen deshalb auch von einer Übergewichts-Epidemie – auch die Schweizer werden jedes Jahr etwas dicker. Doch dies ist kein kardiologisches, sondern ein gesellschaftliches Problem. Wenn Ihr Kardiologe sagt, dass Sie mit dem Rauchen aufhören sollen, hat dies wenig Wirkung. Genützt hat hingegen, dass das Rauchen verteuert und teilweise verboten wurde. Es ist traurig, dass man mit Gesetzen eingreifen muss, aber anders geht es meiner Meinung nach nicht.
Artikel aus unserem Magazin HERZ und Hirnschlag, August 2019
Erfahren Sie mehr
Forschungsförderung der Schweizerischen Herzstiftung
Wie kann man Herzinsuffizienz-Patienten besser behandeln? Was hat Vorhofflimmern mit vaskulärer Demenz zu tun? Weshalb schlagen Frauenherzen anders? Weshalb druckt man vor einer Operation Kinderherzen aus? Die Forschungsbroschüre bietet neue Einblicke in die Schweizer Herz-Kreislauf-Forschung.
Dank Spenden können Herz-Kreislauf-Erkrankungen immer besser erkannt, behandelt oder sogar verhindert werden.
Helfen auch Sie!
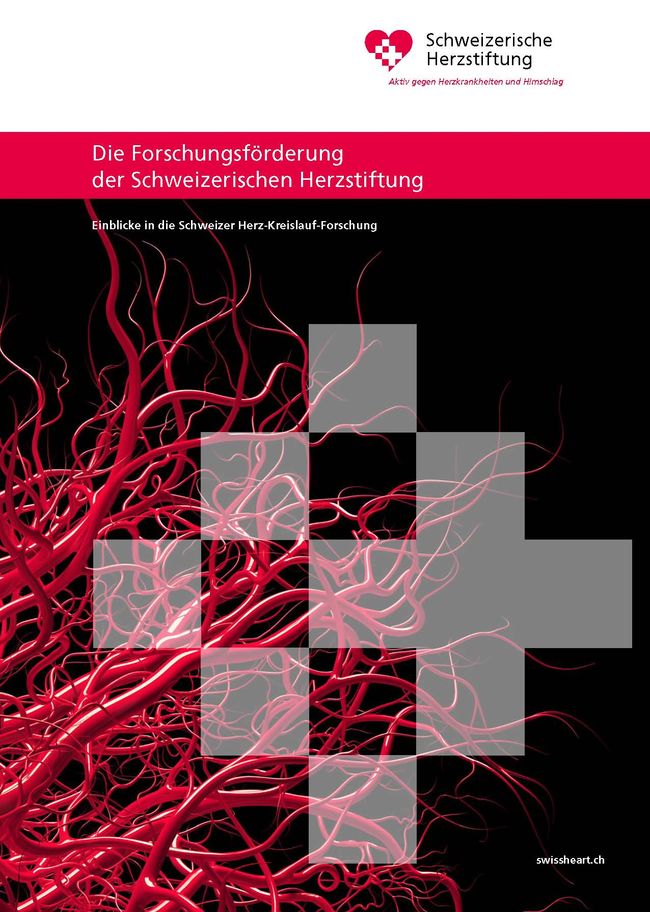
Webseite teilen