Gesundheitliche Folgen
In der Schweiz raucht mehr als ein Viertel der Bevölkerung. Von diesen Rauchern sterben jährlich mehr als 9500 Personen vorzeitig an den Folgen des Rauchens. Diese Folgen zeigen sich zumeist als Herz-Kreislauf-Krankheiten (bei rund 40 Prozent). Personen, die Risikofaktoren für eine Herz-Kreislauf-Krankheit aufweisen (Bluthochdruck, abnorme Blutfettwerte etc.), die bereits einen Herzinfarkt erlitten haben oder die DiabetikerInnen sind, tragen darum ein besonders hohes Risiko, wenn sie rauchen.
Rauchen und Herz-Kreislauf
Rauchen schadet in erster Linie dem Herzen, was noch zu wenig bekannt ist. Auch bei geringem Konsum und kurzer Dauer zeigen sich schon erste Gefährdungen. Herzinfarkt in einem Alter unter 45 Jahren ist bei 4 von 5 Opfern auf das Rauchen zurückzuführen.
Rauchen schadet den Gefässen in dreierlei Hinsicht:
- Kurzfristige Folgen: Rauchen verursacht eine akute Arterienkontraktion. Diese Spasmen können plötzliche kardiovaskuläre Notfälle wie Herzinfarkt, Hirnschlag oder plötzlicher Tod erklären.
- Langfristige Folgen: Rauchen schädigt ganz allmählich die Gefässinnenwände. Wenn zudem noch weitere Risikofaktoren wie ungünstige Blutfettwerte, Diabetes oder Bluthochdruck vorhanden sind, multiplizieren sich die Gefahren.
- Kohlenmonoxid: dieses Nebenprodukt aus dem Verglimmen der Zigarette erreicht sofort die Blutkörperchen und verdrängt dort den Sauerstoff.
Arteriosklerose - Ursache von Durchblutungsstörungen
Der Mensch ist so alt wie seine Blutgefässe. Elastische, jung gebliebene Gefässe garantieren eine gute Blutversorgung des Körpers und halten den Organismus fit. Anders sieht es aus, wenn die Blutgefässe von Arteriosklerose (Arterienverkalkung) betroffen sind. Durch die verengten Gefässe gelangt nur noch wenig Blut in die Gewebe. Diese Minderdurchblutung mit ungenügender Sauerstoffversorgung kann zu vielfältigen Beschwerden und Erkrankungen führen. Die häufigsten sind:
- Angina pectoris durch eine Verengung der Herzkranzgefässe
- Herzinfarkt durch den Verschluss eines Herzkranzgefässes
- Hirnschlag durch den Verschluss einer Hirnarterie
- Periphere arterielle Verschlusskrankheit (Schaufensterkrankheit) durch die Verengung einer Beinarterie
Nicht jeder Mensch ist in gleichem Mass von Arteriosklerose betroffen. Der Gesundheitszustand der Blutgefässe hängt von vielen Umständen ab, namentlich von verschiedenen Risikofaktoren, welche die Arteriosklerose fördern. Ausser den zwei nicht beeinflussbaren Faktoren wie Alter - das Risiko einer arteriosklerotischen Erkrankung nimmt für Männer ab 45 und für Frauen ab 55 Jahren deutlich zu - und familiärer Veranlagung können alle übrigen Risiken wie
- Rauchen
- Erhöhter Blutdruck
- Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus)
- Bewegungsmangel
- Übergewicht
- Stress
...glücklicherweise durch eine herzgesunde Lebensweise beeinflusst werden. Diese Risikofaktoren zu vermeiden, auszuschalten oder soweit möglich zu behandeln, ist das beste Rezept, um möglichst lange herzgesund zu bleiben.
Rauchen und Diabetes
Sowohl das Rauchen wie der schlecht eingestellte Diabetes schaden den Blutgefässen. An Diabetes erkrankte Menschen, welche zudem rauchen, haben deshalb ein deutlich höheres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen (z.B. für Herzinfarkt und Hirnschlag). Der Tabakrauch enthält unzählige toxische Gase. Beim Rauchen filtert die Lunge zwar den Feinstaub (Teer) aus dem Rauch heraus. Zahlreiche Tabakgase gelangen aber ins Blut und begünstigen die Entstehung von Arteriosklerose, Gefässverengung und Minderdurchblutung, aber auch von Krebs. Eine gute Blutversorgung des Körpers und seiner Organe ist gerade für Diabetikerinnen und Diabetiker enorm wichtig, denn nur so können die verschiedenen diabetischen Folgekrankheiten vermieden oder zeitlich hinausgeschoben werden. Der Rauchstopp ist deshalb eine sehr wichtige Gesundheitsmassnahme für Menschen mit Diabetes (Typ 1 und Typ 2).
Welche Folgen kann das Rauchen haben?
Diabetes erhöht das Risiko für Herz-Kreislauf-Krankheiten um das Zwei- bis Vierfache. Durch das Rauchen befindet sich zudem vermehrt schädliches LDL-Cholesterin im Blut und setzt sich an den verletzten Gefässwänden ab. Dadurch werden arteriosklerotische Ablagerungen und Verengungen in den Gefässen begünstigt. Auch andere diabetische Komplikationen wie Augen-, Nieren- und Nervenschäden treten beim Rauchen häufiger auf. Diese Folgeschäden beeinträchtigen die Lebensqualität zunehmend und können sogar zu einer frühzeitigen Invalidität führen. Wenn Diabetiker rauchen, erhöht sich das gesamte Sterblichkeitsrisiko. Eine Studie hat z.B. ergeben, dass bei rauchenden Frauen mit Typ-2-Diabetes die Sterblichkeit um 43 bis 119 Prozent erhöht ist — je nach Zahl der täglich gerauchten Zigaretten.
Besonderheiten des Rauchstopps bei Diabetikerinnen und Diabetikern
Menschen mit Diabetes sollten beim Rauchstopp einige besondere Regeln beachten. Das Rauchen kann die Insulinresistenz und damit den Blutzucker erhöhen. Wenn Sie aufhören, muss möglicherweise Ihre Behandlung neu eingestellt werden. Die Entwöhnung vom Nikotin kann zudem Symptome hervorrufen, die an eine Unterzuckerung erinnern. Sprechen Sie mit einer Fachperson, wenn Sie den Schritt in die Rauchfreiheit machen möchten.
Wo erhält man zusätzliche Beratung?
Beim Arzt oder an einem der Standorte der Schweizerischen Diabetes-Gesellschaft:
Weitere Informationen
Die Broschüre «Rauchen & Diabetes» beinhaltet Informationen im Zusammenhang mit Rauchen und Diabetes und welche gefährlichen Folgen diese Kombination hat. Nebst den Tipps für einen Rauchstopp sind auch Beratungsstellen von allen Sprachregionen der Schweiz aufgeführt.
Die Broschüre «Rauchen und Diabetes» kann über info@diabetesschweiz.ch angefordert werden.
Rauchen und die Atemwege
Rauchende sind vom Nervengift Nikotin abhängig. Das Schädlichste am Rauchen sind jedoch Kohlenmonoxid und Teer, die beim Verbrennungsprozess entstehen und die Gesundheit von Rauchenden nachhaltig schädigen. Darüber hinaus sind weitere Toxine, wie z.B. Nitrosamine oder Cyanid, Schwermetalle, Blausäure und Polonium, welche die schädigenden Auswirkungen des Rauchens verstärken. Es gibt keine Konsummenge an Tabak, die aus gesundheitlicher Sicht unbedenklich ist. Über die Zeit kumulieren sich die krebserregenden Stoffe in der Lunge und eine Verstrahlung des Rauchenden durch die Ablagerungen in seiner Lunge ist eine der bedenklichen Folgen langen Rauchens. Lungenkrebs ist die bekannteste und häufigste Krebsart, aber weitere Krebsarten sind ebenso meist durch das Rauchen beeinflusst.
Chronisch obstruktive Lungenerkrankungen
Es handelt sich hier um eine Kombination der chronischen Bronchitis (Entzündung) mit einer Verengung der Bronchien und als Folge davon um eine Überblähung der Lungenbläschen (Lungenemphysem). Die einmal zerstörten Lungenbläschen sind nicht zu ersetzen. Statt unzähliger Kleinbläschen (mit einer grossen Oberfläche für den Gasaustausch) entstehen grosse Blasen, die nur mehr Bruchteile der früheren Oberfläche bieten. Das Lungenvolumen ist reduziert, die Atmung und damit der Gasaustausch zwischen der frischen Atemluft und dem Blut ist erschwert. Der Sauerstoffgehalt des Blutes nimmt ab. Der Rauchstopp kann keine Vermehrung der Lungenbläschen herbeiführen, aber das aktuelle Lungenvolumen kann mit einem sofortigen Rauchstopp erhalten werden.
Rauchen und Schwangerschaft
Die Toxine (aus dem Inhalations-Rauch der Mutter), die teilweise die Plazentaschranke überwinden, ebenso wie der Mangel an Sauerstoff im mütterlichen Blut, sind entscheidend beteiligt an vielerlei direkten und späten Folgen für die Gesundheit des Babys.
Passivrauchen
Passivraucher haben ein um 23 Prozent erhöhtes Risiko für Angina Pectoris. Nichtraucher, die mit Rauchenden im gemeinsamen Haushalt leben, tragen ein um 20 Prozent höheres Risiko, an Lungenkrebs zu erkranken. Passivrauchen verursacht ebenfalls Asthma und Infektionen der Atemwege. Das Bundesamt für Gesundheit schätzt, dass in der Schweiz jedes Jahr 1000 Menschen am Passivrauchen sterben. Sämtliche anderen Folgen, wie jene für das Herz-Kreislauf-System, treffen den Nichtraucher ebenfalls - je nach Dauer der Exposition. Insbesondere die Belastung durch Passivrauchen am Arbeitsplatz muss vermieden werden, wie neue Studien schlüssig belegen. Der Rauch aus dem brennenden Zigarettenende, der so genannte Nebenstromrauch, weist eine tiefere Temperatur und einen anderen Säuregehalt auf als der direkt eingeatmete. Es finden sich darin höhere Werte an toxischen Substanzen.


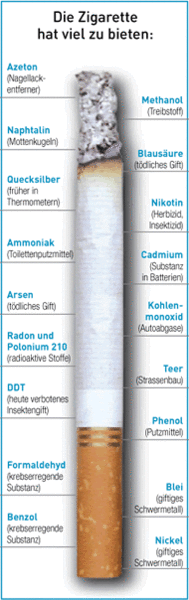
Webseite teilen