Verstehen, wie wir die Behandlung von Herzinsuffizienz-Patienten verbessern können
Immer mehr Menschen erkranken an einer Herzinsuffizienz. Die Behandlungsmöglichkeiten sind eigentlich gut erforscht. Doch lange nicht alle Betroffenen erhalten die für sie optimale Therapie – mit gravierenden Folgen für die Lebensqualität und -erwartung. Ein Forschungsprojekt will herausfinden, wo es Lücken gibt.
Herzschwäche tönt zunächst einmal etwas harmlos. Dahinter versteckt sich aber eine schwere Krankheit. Wann spricht man von einer Herzinsuffizienz?
Prof. Roger Hullin: Die Herzschwäche oder Herzinsuffizienz ist eine systemische Krankheit, die entsteht, wenn das Herz in seiner Pumpfunktion oder Pumpleistung eingeschränkt ist. Dabei gibt es verschiedene Formen. Das Herz kann schwächer werden in seiner Pumpfunktion, zum Beispiel nach einem Herzinfarkt. Wir kennen aber auch Patienten, die ein normal funktionierendes Herz haben und trotzdem Symptome einer Herzschwäche aufweisen. Die Pumpfunktion ist zwar erhalten, jedoch ist die Befüllung des Herzens eingeschränkt. Mittlerweile wissen wir, dass es auch Patienten gibt, die sich zwischen beiden Gruppen befinden.

Wie äussern sich die Symptome?
Herzinsuffizienz-Patienten entwickeln schon bei einer kleinen körperlichen Anstrengung eine muskuläre Müdigkeit und Kurzatmigkeit. Ist die Herzinsuffizienz stärker ausgeprägt, dann hält der Körper Flüssigkeit zurück. Dies macht sich durch Anschwellen der Füsse oder Knöchel bemerkbar, man kann nur noch schlecht in die Schuhe hineinschlüpfen. Wenige Patienten haben auch Wassereinlagerungen im Bauch.
Wie viele Menschen erkranken daran?
Die Herzinsuffizienz ist leider häufig. Mindestens zwei Prozent der Bevölkerung sind betroffen, neuste Daten tendieren gar gegen vier Prozent. Grund dafür ist, dass vor allem in den westlichen Ländern die Anzahl älterer Menschen zunimmt. Unter 65 Jahren ist die Krankheit eher selten. Aber gerade die Herzinsuffizienz bei erhaltener Pumpfunktion nimmt mit dem Alter rapide zu, jeder Fünfte über 80 Jahren ist davon betroffen.

Im Interview
Prof. Dr. med. Roger Hullin leitet die Bereiche schwere Herzinsuffizienz, Herzunterstützungssysteme und Herztransplantation am Universitätsspital Lausanne, CHUV.
Obwohl die Krankheit häufig vorkommt, ist sie wenig im Bewusstsein der Bevölkerung verankert. Stimmt diese Einschätzung?
Dank guter Kampagnen in den vergangenen Jahrzehnten kennen die meisten die Herzinfarkt-Symptome und können sich darunter etwas vorstellen. Bei der Herzinsuffizienz ist dies leider noch anders. Sowohl Patienten als auch Ärzte kennen sie noch zu schlecht. Die Krankheitsbeschwerden werden oft mit dem Alter in Verbindung gebracht, obwohl es sich um eine Herzinsuffizienz handelt, die man behandeln und verbessern kann.
Was sind die Folgen einer unzureichenden oder fehlenden Behandlung?
Die letzte Konsequenz ist, dass Betroffene schneller sterben, verbunden mit einem schwierigen Sterbeprozess. Üblicherweise verkleinert sich zunächst der körperliche Aktivitätsradius, die Beine schwellen an, später tritt Atemnot auch in Ruhe auf. Häufige Spitaleinweisungen sind nötig, welche die Betroffenen und Angehörigen belasten.
Eine gute Behandlung erhält Lebensqualität. Wie geht man vor?
Nach 40 Jahren Forschung wissen wir, welche Medikamente wirksam sind bei vergleichsweise niedrigem Nebenwirkungsprofil. Oft verabreichen wir zwei, drei oder gar vier Medikamente, damit wir eine Stabilisierung oder gar Verbesserung erreichen. Die Therapie erfolgt meist ein Leben lang, deshalb müssen die Patientinnen und Patienten auch regelmässig zur ärztlichen Kontrolle.
Welche Schwierigkeiten bei der Behandlung erfahren Sie als Arzt?
Medikamente haben für die Patienten gelegentlich unangenehme Wirkungen. Diese unangenehmen Wirkungen können durchaus beabsichtigt sein: Bei einem Herzinsuffizienz-Patienten zum Beispiel, der über Jahrzehnte einen hohen Blutdruck hatte, kann die Blutdrucksenkung zur Entlastung des Herzens beschwerlich sein. Er spürt vermehrte Müdigkeit, Schwindel, Beeinträchtigung bei sexueller Aktivität. In einem solchen Fall braucht man als Patient also ein gewisses Durchhaltevermögen, bis man sich an die Therapie gewöhnt hat und merkt, dass sich die Leistungsfähigkeit verbessert. Aber eben, viele Nebenwirkungen sind echte Nebenwirkungen und müssen für die Verbesserung in Kauf genommen werden. Das ist nicht leicht, nicht für den betroffenen Patienten und nicht für den Arzt.
Auch der gesundheitliche Fortschritt kann für die Therapie zum Hindernis werden.
Wenn es dem Patienten mit den Medikamenten bessergeht, will er sie meist reduzieren. Denn es geht ihm ja besser. Wir wissen aber, dass wir die Medikamente weitergeben müssen, damit die Leistungsfähigkeit des Herzens sich weiter verbessert oder zumindest erhalten bleibt.
Ihr aktuelles Forschungsprojekt will die Behandlung von Herzinsuffizienz-Patienten verbessern. Dazu erstellen Sie ein Register. Was muss man sich darunter vorstellen?
Das Register ist eine Liste, die Herzinsuffizienz- Patienten dokumentiert – sofern sie ihre Einwilligung geben. Wenn wir Tausende von Patientinnen und Patienten erfassen, können wir aus den Daten umfassende Profile erstellen. Dies ermöglicht uns, zu beobachten, was mit ihnen im Verlaufe der Behandlung passiert. Solche Register sind aufwendig und kosten viel Geld. Dazu brauchen wir Drittmittel von Organisationen wie der Schweizerischen Herzstiftung.
Welche Informationen erhoffen Sie sich konkret von diesem Register?
Wir wissen viel über die Patienten, die wir an den grossen Spitälern behandeln. Über diejenigen, welche der Hausarzt oder der niedergelassene Kardiologe betreut, wissen wir hingegen sehr wenig. Unter welchen Symptomen leiden die Patienten? Aufgrund welcher Symptome hat der Arzt oder die Ärztin mit einer Therapie begonnen? Welche Form der Herzinsuffizienz haben die Patientinnen und Patienten? Sind sie depressiv verstimmt und brauchen Unterstützung, um die Therapie besser einhalten zu können? Reichen die verabreichten Medikamente aus? Dies sind alles Fragen, auf die wir mit den momentan verfügbaren Daten keine Antwort haben. Solange diese Daten fehlen, können wir auch keine geeigneten Massnahmen ergreifen.
Welche Massnahmen schweben Ihnen vor?
Wir suchen nach Verbesserungsmöglichkeiten bei der Therapie. Zum Beispiel, indem wir die betreuenden Ärztinnen und Ärzte hinsichtlich der medikamentösen Behandlung fortbilden. Weiter wollen wir das Wissen bei den Betroffenen in der Bevölkerung erhöhen, damit sie rechtzeitig eine Behandlung erhalten. Dies ist ein langfristiges Ziel und braucht wohl zusätzliche Kampagnen. Aber auf diesem Weg können wir erreichen, dass wir künftig eine schwere Volkskrankheit besser in den Griff bekommen.
Swiss Herzinsuffizienz Initiative (SWISS-HFI)
Das Forschungsprojekt Swiss Heart Failure-Initiative ist von der Schweizerischen Herzstiftung mit 75'000 Franken unterstützt worden. Rund 80 in der Primärversorgung tätige Ärztinnen und Ärzte werden dazu rekrutiert. Sie erfassen die Patientendaten ihrer Herzinsuffizienzpatienten für das Register. Die Erfassung soll in regelmässigen Abständen wiederholt werden, um sowohl die Fortschritte als auch die Veränderungen des klinischen Profils der Patientinnen und Patienten zu dokumentieren.
Erfahren Sie mehr
Forschungsförderung der Schweizerischen Herzstiftung
Wie kann man Herzinsuffizienz-Patienten besser behandeln? Was hat Vorhofflimmern mit vaskulärer Demenz zu tun? Weshalb schlagen Frauenherzen anders? Weshalb druckt man vor einer Operation Kinderherzen aus? Die Forschungsbroschüre bietet neue Einblicke in die Schweizer Herz-Kreislauf-Forschung.
Dank Spenden können Herz-Kreislauf-Erkrankungen immer besser erkannt, behandelt oder sogar verhindert werden.
Helfen auch Sie!
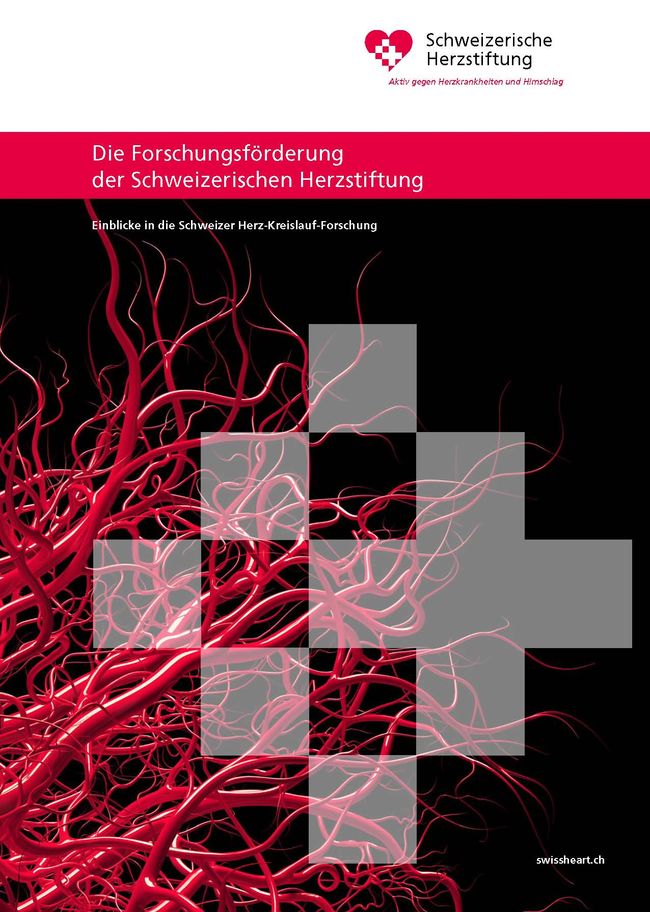
Webseite teilen