Wie beeinträchtigen Herzrhythmusstörungen unser Gehirn?
Dass Vorhofflimmern einen Hirnschlag auslösen kann, weiss man schon seit längerem. Vieles aber ist noch unklar: Wann und wie entstehen gefährliche Gerinnsel? Können sie auch unbemerkt im Gehirn Schaden anrichten? Ist die Herzrhythmusstörung Ursache für eine Leistungseinbusse des Gehirns oder gar eine Demenz? Ein breit angelegtes Forschungsprojekt, geleitet von Prof. Michael Kühne, geht diesen Fragen nach.
Vorhofflimmern tritt vermehrt in den Fokus kardiologischer Forschung. Wie häufig ist die Erkrankung?
Prof. Michael Kühne: Sie steht zuoberst auf unserer Liste möglicher Ursachen, wenn Patienten mit Symptomen wie Herzrasen oder Herzstolpern zu uns kommen. Vorhofflimmern ist die häufigste anhaltende Herzrhythmusstörung, die wir im klinischen Alltag antreffen.
Was passiert bei Vorhofflimmern mit dem Herzen?
Der normale Herzrhythmus wird von unserem Taktgeber, dem Sinusknoten, regelmässig stimuliert. Der Sinusknoten kann jedoch ausfallen. Wenn dann der Herzrhythmus chaotisch wird, bezeichnen wir dies als Vorhofflimmern. Der Vorhof selber schlägt dabei nicht mehr regelmässig mit 50 bis 80 Schlägen pro Minute, sondern ganz unregelmässig und viel zu schnell, mit 300 bis 500 Schlägen pro Minute. Bei einer solch unkoordinierten Geschwindigkeit kann sich der Vorhof nicht mehr zusammenziehen, sondern wackelt oder flimmert nur noch. Zusätzlich befeuern unkontrollierte elektrische Reize den AV-Knoten, der die Überleitung der Erregung in die Herzkammern verwaltet. Dadurch schlagen auch die Herzkammern unregelmässig und meistens zu schnell. Die Rhythmusstörung kann in Episoden oder bei lange bestehender Erkrankung auch dauerhaft vorkommen.
Wie kann man neben Herzrasen oder -stolpern das Vorhofflimmern sonst noch bemerken?
Betroffene Patienten verspüren einen unregelmässigen oder bei körperlicher Belastung zu rasch ansteigenden Puls. Herzklopfen kann ebenfalls ein Symptom sein. Andere Patienten erleben Leistungseinbussen oder Atemnot beim Treppensteigen, wenn sie eine Episode von Vorhofflimmern haben. Ein relevanter Teil der Betroffenen aber, etwa 30 Prozent, hat gar keine Symptome und das Vorhofflimmern wird zufällig entdeckt.

Was sind die Folgen dieser chaotischen Herztätigkeit?
Unmittelbare Gefahr ist der Hirnschlag. Durch die unregelmässige Tätigkeit des Vorhofs kann sich ein Gerinnsel bilden, das in die Blutzirkulation des Gehirns gelangen und dort zu einem akuten Verschluss führen kann. 20 Prozent der Hirnschläge sind auf das Vorhofflimmern zurückzuführen und meist sind diese besonders schwerwiegend, da die Gerinnsel verhältnismässig gross sind. Wird das Vorhofflimmern zu lange nicht behandelt, nimmt auch das Herz selbst Schaden. Durch die unregelmässige Herztätigkeit pumpen die Herzkammern immer schlechter, was mit der Zeit in einer Herzschwäche (Herzinsuffizienz) mündet. Umgekehrt kann eine bestehende Herzinsuffizienz ein Vorhofflimmern hervorrufen.
Weiss man, wie ein solches Blutgerinnsel entsteht?
Auch nach Jahrzehnten intensiver Forschung ist noch einiges unklar. Die Hypothese, teils durch Daten gestützt, ist folgende: In einem Teil des Vorhofs, dem sogenannten Vorhofsohr, ist die Wand nicht glatt, sondern mit Wölbungen übersäht. Wenn sich das Vorhofsohr durch das schnelle unregelmässige Zusammenziehen nicht mehr richtig entleeren kann, können sich in diesen Wölbungen Gerinnsel bilden. Man weiss aus Autopsien bei Patienten nach einem Hirnschlag, dass sich die allermeisten Gerinnsel im Vorhofsohr befinden. In Ultraschall- Untersuchungen im Zusammenhang mit operativen Eingriffen am Herz findet man ebenfalls dort die meisten Gerinnsel. Wann und aufgrund welcher Faktoren ein solches Gerinnsel entsteht, ist damit jedoch noch nicht erklärt.
Gerinnsel lösen sich aber offenbar nicht nur unmittelbar während einer Vorhofflimmer-Episode.
Genau. Dies ist für uns ein wichtiger Aspekt und bildet einen unserer Forschungsschwerpunkte. Bei Patienten mit Vorhofflimmern, die man mit einem implantierten Aufzeichnungsgerät dauerhaft auf Rhythmusstörungen überwacht, stellt man fest, dass der Zeitpunkt des Hirnschlags und der Episoden des Vorhofflimmerns nicht immer miteinander übereinstimmen. Gewisse Patienten haben seit Monaten kein Vorhofflimmern mehr und erleiden dann doch einen Hirnschlag. Man könnte die Hypothese aufstellen, dass das Gerinnsel zwar während des Vorhofflimmerns entsteht, aber sich grundsätzlich jederzeit lösen kann. Zudem wird die Frage aufgeworfen, ob gewisse Hirnschläge bei Patienten mit Vorhofflimmern eben zumindest zum Teil auch andere Ursachen haben als das Vorhofflimmern.
Reicht das Auftreten der Rhythmusstörung alleine als Erklärung also nicht aus, dass es zu einem Hirnschlag kommt?
Nein. Patienten mit dauerhaftem (persistierendem) Vorhofflimmern haben häufiger einen Hirnschlag als Patienten mit anfallsartig auftretendem (paroxysmalem) Vorhofflimmern. Nun könnte man daraus schliessen, dass die Erstgenannten einfach längere Zeit Vorhofflimmern und deshalb auch häufiger einen Hirnschlag haben. Aber so einfach ist es nicht. Patienten mit dauerhaftem Vorhofflimmern sind auch kränker, sie leiden häufiger unter Herzinsuffizienz, Diabetes oder Bluthochdruck. Es könnte also massgeblich an den zusätzlichen Faktoren liegen, dass jemand einen Hirnschlag erleidet oder nicht. Dies untersuchen wir im Forschungsprojekt Swiss AF-Burden.
Wie kann man das Risiko der Gerinnselbildung abschätzen?
Heute arbeiten wir mit sogenannten Scores. Aufgrund der Risikoabschätzung mit einem Score, also ob ein Patient beispielsweise zusätzlich an Bluthochdruck oder Diabetes leidet, entscheiden wir über die vorbeugende Behandlung. Die meisten älteren Patienten erhalten eine Blutverdünnung, um eben solche Gerinnsel zu verhindern. Bei jüngeren Patienten mit einem tiefen Score und dementsprechend tiefem Risiko kann man unter Umständen darauf verzichten. Doch die Bücher diesbezüglich sind noch nicht geschlossen, und es besteht die Hoffnung, die Scores in Bezug auf ihre Voraussagekraft des Hirnschlags in der Zukunft verbessern zu können. Was im Moment in den Scores gar nicht beachtet wird, ist der zeitliche Anteil von Vorhofflimmern bei einem Patienten.
Vorhofflimmern verursacht nicht nur Hirnschläge. Vermutlich sind auch Störungen der Gehirnleistung oder eine Demenz damit verbunden. Was weiss man darüber?
Die Forschung auf diesem Gebiet ist noch jung. Daten aus Untersuchungen zeigen, dass bei Personen mit der Diagnose Vorhofflimmern die kognitive Leistung abfällt verglichen mit Personen ohne Vorhofflimmern. Dies beweist allerdings noch keinen kausalen Zusammenhang. Aber die Verbindung besteht und wir wollen diese besser verstehen. Deshalb führen wir bei unseren Patienten in der Studie auch verschiedene Tests zur Abschätzung der Hirnleistung und mittels Magnetresonanz-Tomographie (MRI) eine Bildgebung des Gehirns durch.
Was haben Sie bislang entdeckt?
Unsere Patienten mit Vorhofflimmern zeigen im MRI erhebliche Veränderungen im Gehirn, einige aufgrund eines erlittenen Hirnschlags. Die meisten aber hatten nie ein spürbares Ereignis und waren deswegen nie vorgängig in ärztlicher Behandlung. Die Hypothese besteht darin, dass es sich bei diesen Patienten zumindest zum Teil um kleine, unbemerkte Hirnschläge handelt, die eben dennoch Spuren hinterlassen. Solche Veränderungen machen sich auch in einfachen kognitiven Tests bemerkbar. So ist auch in unserer Untersuchung bei einem Viertel der Vorhofflimmer-Betroffenen die Leistung des Gehirns deutlich eingeschränkt. Aber eben, dies beweist nur einen Zusammenhang und keine Kausalität.
Könnte der Abbau der Gehirnleistung durch eine blutverdünnende Behandlung verhindert werden – ähnlich wie der Hirnschlag?
Dies entspricht unserer Hypothese und wäre natürlich wünschenswert. Wenn wir mit einer gerinnungshemmenden Therapie das Risiko der Hirnschläge reduzieren, sollten wir damit auch die kleineren, unbemerkten Hirnschläge verhindern können – und damit hoffentlich den Abbau der kognitiven Leistung. Erste Zahlen aus Skandinavien bestätigen dies. Allerdings stammen diese aus einem rückblickenden Register und sind deshalb mit Vorsicht zu deuten.
Neben der vorbeugenden Blutverdünnung besteht auch die Möglichkeit, das Vorhofflimmern direkt zu behandeln. Reduziert eine solche Behandlung auch das Hirnschlagund Demenzrisiko?
Die Rhythmusstörung per se kann man ebenfalls mit Medikamenten behandeln. Sie genügen anfänglich oft, wirken langfristig aber schlecht. Nach einer gewissen Zeit müssen viele Patientinnen und Patienten einem minimalinvasiven Eingriff am Herzen zugeführt werden. Dabei werden eine kleine Sonde über die Leiste ins Herz vorgeschoben und dort die Entstehungsorte des Vorhofflimmerns verödet. Ausschlaggebend für eine solche Behandlung ist, wie stark der Patient Symptome verspürt und wie sehr seine körperliche Leistungsfähigkeit beeinträchtigt ist. Ob die Behandlung auch Hirnschlägen oder der Einbusse der Gehirnleistung vorbeugt, wissen wir heute noch nicht.
Wie wird sich die medizinische Hirnschlag-Prävention bei Vorhofflimmern künftig verbessern?
Der bereits erwähnte Score ist recht grob. Wir wollen mit unserer Forschungsarbeit dazu beitragen, ein feineres, besseres Instrument zu erhalten. In Zukunft sollten wir noch genauer wissen, ob jemand einen Nutzen von einer vorbeugenden Behandlung hat und wie gross dieser ist. Und natürlich auch, wie gross für jeden das Risiko für eine Blutung durch Blutverdünner ist. Je nach Resultat unserer und anderer Forschungsarbeiten werden wir die Behandlung überdenken müssen.
Vorausgesetzt, man erhält eine rechtzeitige Diagnose.
Absolut, deshalb ist ein weiteres wichtiges Ziel, dass wir Ärztinnen und Ärzte die Diagnose bei den Betroffenen möglichst früh stellen. Dazu benötigen wir ein Netzwerk, das dies ermöglicht. Wie bereits erwähnt, bemerken viele Patienten ihre Herzrhythmusstörung nicht. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, dass man die Kontrolle des Herzrhythmus in den HerzCheck der Schweizerischen Herzstiftung integriert.
Ihr Forschungsprojekt ist aufwändig. Wie wichtig ist die Zusammenarbeit mit Forschenden aus anderen Disziplinen?
Sie ist enorm wichtig. Als Kardiologen schauen wir uns das Herz an. Doch wir sind nicht spezialisiert auf neurologische Erkrankungen oder die Bildgebung des Gehirns. Deshalb arbeiten wir eng mit Radiologen und Neurologen, aber auch mit Laborspezialisten für Biomarker-Analysen und Genetik zusammen.
Zum Schluss eine persönliche Frage: Was wünschen Sie sich als Wissenschaftler und behandelnder Arzt für Ihre Patienten?
Das Spektrum unserer Patientinnen und Patienten mit Vorhofflimmern ist gross. In meiner Sprechstunde sehe ich Patienten im Alter von 25 bis 95 Jahren. Mein Wunsch ist, dass wir dereinst jeder Patientin und jedem Patienten eine massgeschneiderte Therapie anbieten können. Einerseits um das Vorhofflimmern in den Griff zu bekommen, andererseits um das Risiko eines für Betroffene, aber auch für Angehörige sehr belastenden Hirnschlags zu minimieren.
Die Studie Swiss-AF-Burden
Die Schweizerische Herzstiftung unterstützt im Rahmen des 50-jährigen Bestehens das Projekt Swiss-AF-Burden von Prof. Michael Kühne mit 500'000 Franken. Die vom Schweizerischen Nationalfonds unterstützte Swiss-AF Studie untersucht bei Patienten mit Vorhofflimmern, ob Hirnläsionen infolge von Infarkten oder Blutungen, die auch stumm auftreten, ein Grund für die raschere Abnahme der kognitiven Funktion sein könnten. Swiss-AF-Burden untersucht zudem, ob lange andauerndes Vorhofflimmern auch zu mehr Schädigung im Gehirn sowie einer schlechteren Hirnleistung und Herzfunktion führt. In diesem Zusammenhang werden jährlich rund 2400 Patienten mit Vorhofflimmern in 13 Schweizer Kliniken über einen Zeitraum von vier Jahren untersucht.
Erfahren Sie mehr
Forschungsförderung der Schweizerischen Herzstiftung
Wie kann man Herzinsuffizienz-Patienten besser behandeln? Was hat Vorhofflimmern mit vaskulärer Demenz zu tun? Weshalb schlagen Frauenherzen anders? Weshalb druckt man vor einer Operation Kinderherzen aus? Die Forschungsbroschüre bietet neue Einblicke in die Schweizer Herz-Kreislauf-Forschung.
Sehen Sie sich auch den Film über dieses Forschungsprojekt an.
Dank Spenden können Herz-Kreislauf-Erkrankungen immer besser erkannt, behandelt oder sogar verhindert werden.
Helfen auch Sie!
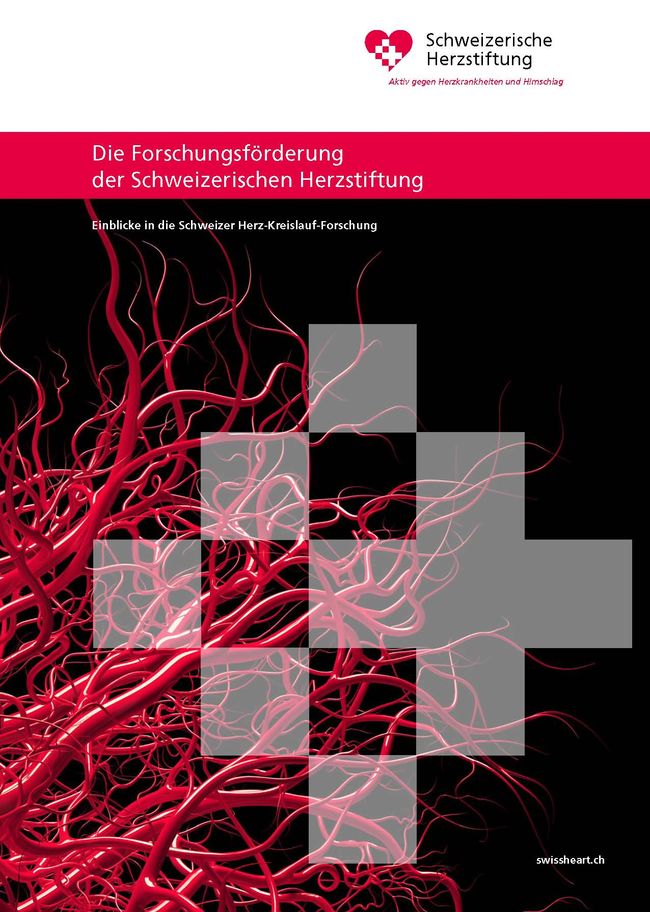
Webseite teilen