Ein Bluttropfen, der Hirnschlagopfern hilft
Trotz der immer besseren Behandlung erleiden viele Betroffene einen zweiten Hirnschlag. Dies will Mira Katan vom Universitätsspital Zürich ändern. Sie erforscht, wie man den unklaren Ursachen im Blut auf die Spur kommt, und sucht nach einer gezielteren Vorbeugung, um weiteres Unglück zu vermeiden.
Welchen falschen Annahmen über den Hirnschlag begegnen Sie als Neurologin?
PD Dr. Mira Katan: Wenn vom Schlaganfall oder Schlegli gesprochen wird, meinen manche immer noch, dass das Herz betroffen ist. Schon die Zuordnung des Ereignisses erscheint also schwierig. Viele glauben zudem, dass der Hirnschlag nur sehr alte und kranke Personen betrifft, was nicht der Fall ist. Schliesslich höre ich oft, dass der Hirnschlag ein Schicksalsschlag ist und man nichts dagegen unternehmen kann. Auch das ist falsch.
Wie viele junge Menschen erleiden einen Hirnschlag?
Alle 35 Minuten erleidet jemand in der Schweiz einen Hirnschlag. Nicht mitgezählt sind solche, die den Hirnschlag zum Beispiel zu Hause erleben und nicht ins Spital kommen. Die Dunkelziffer ist daher sicher höher. Circa 15 Prozent der Betroffenen sind zwischen 18 und 50 Jahren, sogar Kinder können betroffen sein.
Die häufigste Form ist der ischämische Hirnschlag, also eine Durchblutungsstörung im Gehirn. Diese Störung wird durch ein Gerinnsel verursacht, das ein Gefäss verschliesst und die Blutzufuhr blockiert. Wie kommt es zu einem solchen Gefässverschluss?
Die Ursachen sind sehr unterschiedlich – im Gegensatz zum Herzinfarkt, wo ein Grossteil der Gefässverschlüsse auf die Arteriosklerose zurückzuführen sind. Beim Hirnschlag macht die Arteriosklerose der grossen Gefässe etwa 15 bis 20 Prozent aus. Eine weitere häufige Ursache ist die Erkrankung der kleinen Blutgefässe im Gehirn. Ein grosser Anteil der Hirnschläge schliesslich sind kardio-embolisch bedingt. Das heisst, im Herzen befindet sich ein Gerinnsel, das weggeschwemmt wird und ins Gehirn gelangt. Bei 30 Prozent der Patientinnen und Patienten finden wir jedoch trotz aller Untersuchungen nicht eindeutig heraus, was zum Hirnschlag geführt hat.
Welche Folgen hat dies für diese Patient*innen?
Nach der Akuttherapie des Hirnschlags will man unbedingt verhindern, dass sich ein weiterer ereignet. Dazu müssen wir wissen, was den ersten Hirnschlag verursacht hat. Patientinnen und Patienten, bei denen wir dies nicht klar sagen können, erhalten die Standardtherapie zur Hirnschlagprävention. Diese ist zwar wirksam. Wenn wir jedoch die genaue Ursache kennen würden, könnten wir durch eine gezielte Behandlung das Risiko eines zweiten Hirnschlags weiter reduzieren.
Wie viele Betroffene erleben einen weiteren Hirnschlag?
Das sind relativ viele, etwa acht bis zwölf Prozent innerhalb der nächsten fünf Jahre. Dieser Anteil ist in den letzten Jahren leider nicht relevant gesunken.
Wie wollen Sie weitere Hirnschläge verhindern?
Biomarker im Blut helfen uns, die unbekannte Ursache eines Hirnschlags zu ermitteln. Ich habe unter anderem nach einem spezifischen Blutprotein-Biomarker gesucht, der eine zugrundeliegende Herzerkrankung aufdeckt. Nach zahlreichen Studien wissen wir nun, dass bei jemandem mit einem hohen Marker höchstwahrscheinlich eine Erkrankung des Herzens den Hirnschlag verursacht hat. Das heisst, aufgrund einer Herzrhythmusstörung hat sich im Herzvorhof ein Gerinnsel gebildet, das ins Gehirn geschleudert worden ist.
Inwiefern ändert sich dadurch die vorbeugende Behandlung?
Wir können die blutverdünnende Therapie anpassen. Beim Vorhofflimmern ist die Behandlung mit einer oralen Antikoagulation viel wirksamer als die schwächere Standardtherapie mit Plättchenhemmern. Wir gehen also davon aus, dass jemand mit einem hohen Marker von einer stärkeren Blutverdünnung profitiert. Ob dies tatsächlich so ist, müssen wir in einem nächsten Schritt klären.
Wie machen Sie das?
Mit einer sogenannten randomisierten Studie. Wir fragen Hirnschlagpatientinnen und -patienten, ob sie teilnehmen wollen, und teilen sie nach dem Zufallsprinzip in zwei Gruppen auf. Die einen erhalten die bisherige Standardtherapie, die anderen die orale Antikoagulation. Nach einer gewissen Zeit analysieren wir, in welcher Gruppe sich wie viele Hirnschläge ereignet haben. Eine solche Studie läuft momentan gerade mit Unterstützung des Schweizerischen Nationalfonds sowie der Schweizerischen Herzstiftung an verschiedenen Spitälern in der Schweiz und im Ausland.
Was erwarten Sie von den Resultaten?
Ich bin sehr gespannt. Seit Langem habe ich den Traum, dass wir anhand eines einfachen Bluttropfens die Ursache eines Hirnschlags erkennen und die präventive Behandlung verbessern können. Hoffentlich erfüllt er sich, es wäre den Betroffenen zu wünschen.
Sie sind nicht nur Forscherin, sondern behandeln auch Patient*innen im Spital. Welche Arbeit ziehen Sie vor?
Ich mache beides gleich gern, die Aufgaben ergänzen sich. Wenn man klinisch forscht wie ich, sollte man in der Klinik arbeiten. Dort findet man heraus, was im Klinikalltag relevant ist. Also welche Fragen die Forschung klären muss, damit wir den Patientinnen und Patienten, aber auch den Kolleginnen und Kollegen helfen und dadurch etwas bewegen können.
Forschung bewegt also etwas?
Das Schöne ist, dass durch die Forschung nicht nur einem einzelnen Patienten, einer einzelnen Patientin geholfen werden kann. Wenn sich eine Hypothese bestätigt und wir eine bessere Diagnose oder Behandlung finden, profitieren im Prinzip alle zukünftigen Betroffenen auf der ganzen Welt davon. Das empfinde ich als eine sehr sinnvolle Aufgabe.
Die Schweizerische Herzstiftung fördert Forschungsprojekte, um Patienten in Zukunft besser helfen zu können. Helfen auch Sie mit einer Spende.
Artikel aus unserem Magazin HERZ und HIRNSCHLAG, August 2021
Erfahren Sie mehr
Hirnschlag - ein ernstes Ereignis
Was verursacht einen Hirnschlag, wie kann man einem Hirnschlag vorbeugen, wie erkenne ich einen Hirnschlag überhaupt und was steckt eigentlich hinter dem Begriff «Schlegli»? Für Sie ist im Flyer das Wichtigste kurz und übersichtlich aufbereitet.
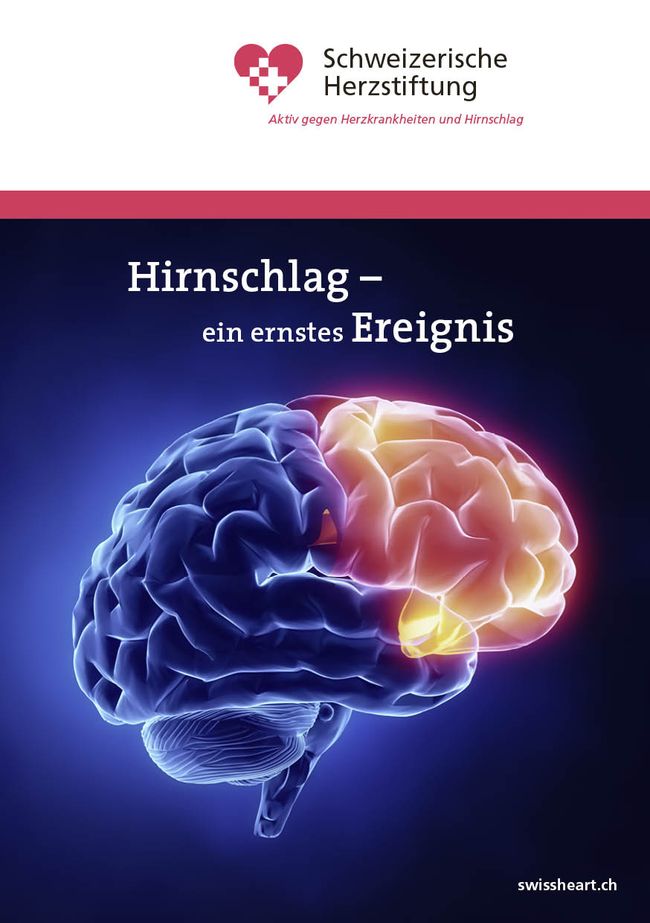
Webseite teilen